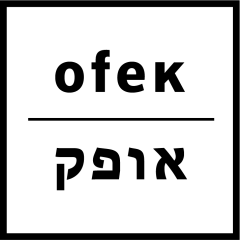Körper in Berlin und Herz in Israel
Psychische Reaktionen von Diaspora-Israelis auf den Krieg und mögliche Bewältigungsstrategien
Der untenstehende Text ist ursprünglich zwei Tage nach den Massakern des 7. Oktober 2023 auf der Webseite der hebräischsprachigen Telefonseelsorge MATAN (in Trägerschaft von OFEK e.V. und ZWST) erschienen. Angesichts der aktuellen Eskalation im Konflikt zwischen Israel und Iran veröffentlichen wir eine deutsche Übersetzung des Textes.
Die unfassbaren Ereignisse in Israel in den letzten Tagen erschüttern uns alle, hier in Deutschland, in Berlin und weltweit. In diesem Artikel möchten wir euch einige natürliche Reaktionen auf ein solches Ereignis beschreiben und mögliche Bewältigungsstrategien anbieten.
Die aktuellen Ereignisse in Israel sind traumatisch für alle, die sie direkt erleben oder erlebt haben – das ist eine bekannte und viel diskutierte Tatsache. Weniger bekannt ist jedoch, dass ein Ereignis auch für Menschen traumatisch sein kann, die es nicht direkt miterlebt haben. Diese Erkenntnis ist besonders bedeutend für die Diaspora und Israelis im Ausland.
Zunächst einmal: Was ist ein traumatisches Ereignis überhaupt? Es handelt sich dabei um ein extremes und unerwartetes Ereignis, das die körperliche und seelische Unversehrtheit bedroht. Das bedeutet Unsicherheit, Kontrollverlust und eine erschütterte Grundsicherheit (zum Beispiel das grundlegende Vertrauen, dass Menschen gut sind, dass unser Zuhause ein sicherer Ort ist und dass es Systeme gibt, die uns schützen).
Es ist ein Ereignis, dass den Rahmen dessen sprengt, was wir üblicherweise als normal empfinden. Daher wirken unsere Bewältigungs-, Verarbeitungs- und Reaktionsmechanismen nicht immer optimal dagegen. In den ersten Wochen nach einem solchen Ereignis werden die meisten von uns Stressreaktionen zeigen (nicht zu verwechseln mit PTSD – posttraumatische Belastungsstörung). Diese Reaktionen sind keine Krankheit, sondern natürlich. So reagieren Menschen auf eine solche Situation.
Ereignisse können auch von Menschen deren Angehörige bedroht sind, auch wenn sie es selbst nicht sind, als traumatisch empfunden werden und Stressreaktionen hervorrufen. Zudem kann auch eine verstärkte Aussetzung mit den Nachrichten und sozialen Medien zu einer traumatischen Erfahrung führen und Stressreaktionen auslösen.
Viele von uns hier in Berlin gehören mindestens zu einer dieser beiden Kategorien. Das bedeutet, dass auch wir ein traumatisches Ereignis erleben und entsprechend reagieren. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Reaktionen äußerst normale und natürliche Reaktionen von Menschen in dieser Situation sind und keinesfalls eine Krankheit oder eine posttraumatische Belastungsstörung darstellen.
Welche natürlichen, akuten Stressreaktionen können wir erwarten?
- Körperliche Reaktionen: Zittern und Beben, Herzrasen und Atemnot, Übelkeit, Brustschmerzen/Kopfschmerzen/Bauchschmerzen, Schwindel, Kalter Schweiß, Licht- und Geräuschempfindlichkeit, vermehrtes Weinen, Schlafprobleme und/oder Albträume. Diese Symptome sind natürliche Reaktionen, die durch die körperliche Erfahrung unseres Nervensystems auf ein traumatisches Ereignis verursacht werden, und auf die wir nochmal näher eingehen werden.
- Emotionale Reaktionen: Angst, Anspannung, Traurigkeit, Gereiztheit, Wut, Stimmungsschwankungen, existentielle Einsamkeit, Verzweiflung, manchmal emotionale Unklarheit oder emotionale Dissoziation. Gefühle von Schuld und Scham – weil man das Gefühl hat, nicht genug zu tun, weil man nicht ständig vor dem Bildschirm ist und sich auf dem Laufenden hält, oder weil man eine Pause macht.
- Kognitive Reaktionen: Unangenehme Bilder, Erinnerungen und Geschichten, die unkontrolliert in unser Bewusstsein eindringen; Konzentrationsschwierigkeiten, Schwierigkeiten bei der Arbeit; wiederkehrende Gedanken, die sich wie Schleifen wiederholen, zum Beispiel „Was wäre wenn…“; Kommunikationsprobleme, Schwierigkeiten, Gedanken in Worte zu fassen oder unsere Gefühle zu beschreiben.
- Soziale Reaktionen: Der Wunsch alleine zu sein; Vermeidung von Menschen, Gesprächen und Situationen, die an das Erlebte erinnern könnten und Angst sowie Belastung hervorrufen.
- Verhaltensreaktionen: Unvorsichtiges oder selbstschädigendes Verhalten, einschließlich verstärktem Konsum von Alkohol, Drogen und Zigaretten sowie erhöhtem Zuckerkonsum und Koffeinaufnahme; Schwierigkeiten, sich von Nachrichten, sozialen Medien und WhatsApp-Gruppen zu lösen; längeres Anschauen von Videos, die Gewalt- und Todesfälle darstellen.
Das sind alles natürliche und erwartbare Symptome bei Menschen in dieser Situation. Was für eine Reaktion würde man in Anbetracht eines solchen Ausmaßes an Ungerechtigkeit erwarten?
Diese und ähnliche Symptome sind meist vorübergehend, variieren im Laufe der Tage und Wochen an Intensität und verschwinden oder verändern sich mit der Zeit. Trotzdem ist es natürlich, dass sie uns beängstigen und wir uns fragen, was wir gegen sie tun können.
Spezifische Reaktionen auf Trauma bei in Berlin lebenden Israelis
Bei in Berlin lebenden Israelis lassen sich zusätzliche Reaktionen auf traumatische Ereignisse erkennen, die mit ihrer komplexen Identität zusammenhängen. Hier einige Erfahrungen, die wir in den letzten Tagen [i.e. in den ersten Tagen nach dem 7. Oktober 2023] im Hotline-Service gehört haben:
- Wie bin ich aus der Ferne beteiligt? Wie kann ich überhaupt aus der Ferne helfen? Wie weit bin ich berechtigt, Schmerz zu empfinden, wenn ich so weit weg bin? Wenn ich privilegiert bin, woanders lebe und nicht direkt betroffen bin? Wenn ich militärische, medizinische oder andere Fähigkeiten habe, sollte ich nach Israel fliegen? Manchmal führen diese Gefühle dazu, dass ständig Versuche unternommen werden, irgendwie Hilfe zu leisten, was zu Erschöpfung und erhöhtem Stress führt.
- Scham- und Schuldgefühle: Scham über die eigenen Stressreaktionen, Schuldgefühle, weil man nicht vor Ort ist; Erleichterung, dass man nicht in Israel ist, aber auch Scham über diese Erleichterung. Schuldgefühle, wenn man nicht ständig vor Bildschirmen sitzt oder mit Angehörigen und Freund*innen in Israel kommuniziert; das Gefühl, nicht „genug“ zu tun; Schuldgefühle, wenn man abgelenkt ist oder etwas anderes tut, anstatt an Israel zu denken. Diese Gefühle führen oft zu Tätigkeiten, die auf dem Versuch basieren, zu helfen, was jedoch zu Erschöpfung und erhöhtem Stress führt.
- Das Gefühl der Einsamkeit und die Schwierigkeit, sich Anderen um sich herum mitzuteilen, weil „ein Außenstehender es nicht verstehen wird“. Eventuell haben wir Schwierigkeiten am Arbeitsplatz zu funktionieren und unsere Arbeitgeber verstehen es nicht; vielleicht können wir unsere Erlebnisse nicht mit nicht-israelischen Kolleg:innen, Nachbar:innen und Freund:innen teilen. Möglicherweise sind wir verletzt, weil Freund:innen nicht antworten oder Unterstützung anbieten, weil sie die Situation nicht verstehen. Vielleicht hören wir politische Kommentare von Freunden, die uns das Gefühl von Entfremdung, Isolation und Schmerz vermitteln.
- Komplexität in Partnerschaften mit Nicht-Israelis, die nicht immer das Verständnis und die Unterstützung bieten können, die wir uns wünschen. So können sich auch Gefühle der Fremdheit und Isolation im eigenen Zuhause entwickeln.
- Gefühle von Bedrohung und Angst vor Angriffen im öffentlichen Raum. Das neue städtische Zuhause wird plötzlich als zu jeder Zeit und an jedem Ort potenziell angreifbar erlebt. Es gibt keinen Frieden, keine Sicherheit und keine Stabilität – nirgendwo. Manchmal geht damit die Angst das Haus zu verlassen einher oder man vermeidet es ganz.
- Werteverwirrung: Unsere Weltanschauungen können sich durch Gewalt und kriegerische Auseinandersetzungen verändern. Manchmal haben wir sogar Schwierigkeiten, unsere Werte überhaupt noch wiederzuerkennen, da sie sich je nach Nachrichten und unseren Gefühlen zu verändern scheinen. Das erschüttert die Grundfesten unserer Identität und führt zu Stress, Verwirrung und Überforderung.
- Neue Beziehungen mit der eigenen israelischen Identität: Als wir uns entschieden haben auszuwandern, haben wir unsere Beziehung zu unserer israelischen Identität verändert, vielleicht hin zu einer Identität als Einwanderer*in, als Weltbürger*in oder als Deutsche*r. Doch die Ereignisse im Land und die Reaktionen in Berlin zwingen uns dazu, den israelischen Teil in uns neu zu erleben. Und nicht bloß zu erleben, sondern unser Israelisch-Sein wieder in unser Leben und unsere psychische Welt zu integrieren – in einer Zeit, in der diese Identität von Angst, Wut, aber auch Verzweiflung, Sorge und anderen schwierigen Gefühlen begleitet wird.
- Welche Leben sollen wir führen? Es entsteht eine Dissonanz zwischen der normalen Realität außerhalb unseres physischen Zuhauses und der unfassbaren, bedrohlichen Realität im geistigen Zuhause. Wir sind zwar Israelis, aber wir sind es auch nicht mehr. Israel ist unser Zuhause, aber wir haben auch noch ein weiteres. Wir haben dort eine Gemeinschaft, und auch hier. Wir fühlen uns hin- und hergerissen, zwischen hier und dort. Die stabile und sichere Grundlage unserer Identität wird erschüttert, ebenso unser Sicherheitsgefühl, unsere Stabilität, unsere Gewissheit und unsere Kontrolle.
- Während Israel als Staat das Leben zum Stillstand bringt, tun wir es nicht. Dieser Widerspruch schafft einige neue Dilemmata:
-
- Wir müssen weiterhin zur Arbeit gehen und die Kinder in Bildungseinrichtungen schicken, obwohl unser Kopf an einem anderen Ort ist. Viele möchten das Haus am liebsten gar nicht mehr verlassen und die Welt fordert es trotzdem von uns. Wie soll man das machen? Und ist es überhaupt richtig, das zu tun? Wie können wir uns vor all dem schützen?
- Wie können wir unseren Kolleg*innen, Erzieher*innen, oder Dozent*innen erklären, dass wir nicht abschalten können? Dass ich nicht wie gewohnt arbeiten und lernen können? Dass unser Kopf dort ist, obwohl unser Körper hier ist? Dass wir den ganzen Tag beim Arbeiten weinen müssen?
- Und generell, was sollen wir mit unserem Leben im neuen Land anfangen? Darf ich mich in meiner Arbeit mit meinen Krisen beschäftigen? Mit der Auswanderung? Mit meinen Beziehungen? Es können Schuldgefühle entstehen, weil wir uns weiterhin mit unserem Leben außerhalb Israels beschäftigen.
Auch in diesen Fällen ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass all diese Reaktionen normale und natürliche Reaktionen auf die Situation von Menschen in diesem Zustand sind.
Was kann ich tun? Neun Bewältigungsstrategien
Zuerst ist es wichtig zu bedenken, dass es sich hier um einen Marathon und nicht um einen Sprint handelt. Es ist sinnvoll, sich darauf einzustellen für mehrere Tage bis Wochen mit den oben genannten Symptomen leben zu müssen. Was bedeutet es, sich auf einen Marathon vorzubereiten? Die Frage ist, wie wir uns in einer anhaltenden Stresssituation schützen können. Wie können wir Ressourcen bewahren und uns neu aufladen, in einer Lage, die unsere Ressourcen erschöpft? Wie können wir zumindest die Schwere der Belastung verringern, auch wenn wir sie nicht vollständig eliminieren können?
Zweitens lasst uns daran erinnern, dass wir keine Kontrolle über das Geschehen haben – weder über den Krieg noch über das, was bei den Soldat*innen und Geiseln passiert. Dennoch können wir lernen, unsere Reaktionen besser zu steuern und die Belastung und den Schmerz zu lindern.
Die meisten von uns haben komplexe Beziehungen mit der Erleichterung von Belastung. Einerseits brauchen wir diese Erleichterung verzweifelt, um zu überleben, andererseits empfinden wir Scham, wenn wir in der aktuellen Situation für uns selbst sorgen. Das ist ganz natürlich. Und gleichzeitig ist die Beruhigung unserer Nerven der einzige Weg, um unser Wohlbefinden und das der anderen in diesem Marathon zu sichern. Aktivitäten, die uns erleichtern, sind kein Zeichen von Gleichgültigkeit und bedeuten nicht, dass wir schlechte Menschen sind. Sie sind ein Zeichen dafür, dass wir uns schützen und auftanken, um weiterhin leben, handeln und anderen helfen zu können.
Wie können wir uns selbst helfen und auftanken? Ein traumatisches Ereignis ist ein körperliches Ereignis, das eine Fehlregulation unseres Nervensystems verursacht und die Hauptursache für die oben genannten Symptome ist. Wenn unser Nervensystem nicht richtig reguliert ist, fällt es uns schwer, klar zu denken, mit anderen zu kommunizieren und effektiv zu handeln.
Daher besteht unser Hauptziel darin, das Nervensystem zu regulieren. Es handelt sich dabei nicht um eine einmalige Aktion; im Verlauf des Tages werden wir das Nervensystem immer wieder neu regulieren, um die Symptome zu lindern. Eine vollständige Beseitigung der Symptome ist bei anhaltenden traumatischen Ereignissen meist nicht möglich.
Wie kann man das Nervensystem regulieren?
- Soziale Interaktion: Gespräche und Blickkontakt mit anderen signalisieren unserem Nervensystem, dass wir sicher sind, und bieten uns gleichzeitig ein Unterstützungssystem. Versucht euch mit Freunden zu treffen, und vielleicht auch eigene Initiativen zu ergreifen – zum Beispiel über verschiedene Facebook-Gruppen, Treffen mit anderen Israelis, auch mit Menschen, die ihr noch nicht kennt.
- Entspannende Aktivitäten: Erstelle eine Liste von 5-10 Ablenkungen, die euch entspannen, beruhigen oder erfreuen. Warum eine Liste? Weil unser Gehirn in Stresssituationen manchmal Dinge vergisst, und eine Liste erinnert uns daran, was uns guttut. Es muss nichts Großes oder Erhabenes sein, sondern etwas, das leicht umzusetzen ist: Kochen, „Friends“ erneut ansehen, zum Supermarkt gehen, Bollywood-Clips schauen, einen Hund streicheln, ein Lieblingslied im Wohnzimmer singen, die Haare färben, Katzenvideos anschauen. Alles ist erlaubt, solange es funktioniert.
- Medienpausen: Unser Nervensystem gerät durch die Flut an Informationen aus dem Gleichgewicht und braucht eine Pause, um sich zu beruhigen. Das Konsumieren von Informationen kann uns aber auch helfen mehr Ruhe und Ordnung zu empfinden, daher sollten wir diesen Wunsch auch akzeptieren. Setzt euch realistische Ziele für Medienpausen – wenn drei Stunden nicht möglich sind, versucht eine Stunde oder sogarnur 15 Minuten. Beginnt mit dem, was machbar ist, und seht, ob ihr es schafft noch längere Pausen einzulegen. Wichtig ist auch, was in diesen Pausen passiert. Es ist empfehlenswert Aktivitäten zu machen, die euch entspannen, oder euch mit anderen Menschen zu treffen, um euren Kopf mit anderen Informationen zu versorgen. Beachtet außerdem, dass das Ansehen und Hören von Informationen unser Nervensystem stärker überflutet als das Lesen von Informationen; also priorisiert es zu lesen.
- Erfüllen von Aufgaben: Das Erledigen von Aufgaben setzt Hormone im Gehirn frei, die helfen, das Nervensystem auszugleichen. Sogar „kleine“ Aufgaben wirken: Geschirr spülen, Wäsche zusammenlegen, den Boden kehren, den Müll rausbringen, usw. Es ist wichtig uns daran zu erinnern, dass wir nicht in allen Bereichen unseres Lebens machtlos sind, dass es immer Dinge gibt, die wir beherrschen und tun können.
- Teilnahme an Hilfsinitiativen: Überlegt, ob ihr auf irgendeine Weise helfen könnt, sei es durch Freiwilligenarbeit, Spenden, Informationsverbreitung, Gestaltung oder Schreiben. Informiert euch über Hilfsaktionen und Initiativen, und schaut euch Videos und Bilder von Menschen an, die helfen. Es ist wichtig uns mit ausgewogenen Informationen zu versorgen und uns daran zu erinnern, dass es auch Gutes und gute Menschen auf der Welt gibt. Jede Form des Handelns erinnert uns daran, dass wir aktiv sein können und nicht nur passive Zuschauer sind in einem schockierenden Ereignis.
- Berührungen: Berührung hilft, das Nervensystem zu regulieren – eine Umarmung, das Streicheln von Tieren, Selbstberührungen für mindestens 45 Sekunden (oder bis eine Erleichterung eintritt) sind sehr hilfreich.
- Körperliche Regulation: Der einfachste Weg, das Nervensystem zu regulieren, ist durch den Körper. Für manche ist Meditation oder Atemübungen hilfreich, für andere Yoga oder Dehnübungen. Bewegungsaktivitäten, welche die großen Muskelgruppen aktivieren – Laufen, Tanzen, Radfahren – funktionieren besonders gut. Es gibt auch Anleitungen für körperliche Erdungsübungen im Internet. Ein schneller Tipp: Spielt ein Lied, das ihr gerne hört, und tanzt im Wohnzimmer voller Energie, auch wenn ihr dabei weinen müsst.
- Gesunde Gewohnheiten: Versucht so viel wie möglich zu schlafen und reduziert den Konsum von Kaffee, Alkohol und Zucker.
- Emotionale Akzeptanz: Manchmal ist der Kampf mit unseren eigenen Gefühlen anstrengender als alles andere. Wir hoffen, dass dieser Text euch geholfen hat zu verstehen, dass alles, was ihr fühlt, normal und vorübergehend ist. Es wird nicht ewig so bleiben. Alle Gefühle, die ihr habt, sind normal und vorübergehend – versucht sie zu akzeptieren, denn sie sind bereits da und sie werden auch wieder vorbeigehen. Es ist eine schreckliche, aber vorübergehende Situation.
Denkt daran, dass jede:r von uns anders ist und unterschiedliche Dinge hilfreich findet. Probiert die oben genannten Ideen aus, bis ihr diejenigen finden, die für euch funktionieren. Wenn etwas nicht wirkt, versucht etwas anderes. Das Ziel ist, eine Erleichterung der Stresssymptome zu erreichen, auch wenn es nicht möglich ist, diese vollständig zu vertreiben: Von einem Stresslevel von 10 auf 7 zu kommen, ist bereits ein Erfolg. Je häufiger ihr euer Nervensystem ausgleicht, desto weniger intensiv wird der Stress im Laufe der Tage sein.
Erinnert euch daran, dass ihr eure eigenen Expert:innen seid. Fragt euch, was euch in der Vergangenheit bei Stress geholfen hat. Was fällt euch als erstes ein? Was sagt euer Bauchgefühl? Beginnt mit den Dingen, die euch als erstes einfallen und die euch schon früher geholfen haben.
Wenn sich in fünf Wochen keine Veränderung bei euren Empfindungen und ihrer Intensität zeigt, empfehlen wir professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Denkt daran, dass wir für telefonische Unterstützung jeden Tag erreichbar sind. Die Hotline ist von 20:00 bis 22:00 Uhr unter der Nummer 0800-0001642 (für Anrufe aus Deutschland), +493023283794 (für Anrufe aus ganz Europa), sowie per WhatsApp unter der Nummer +49-176-84958019 offen.